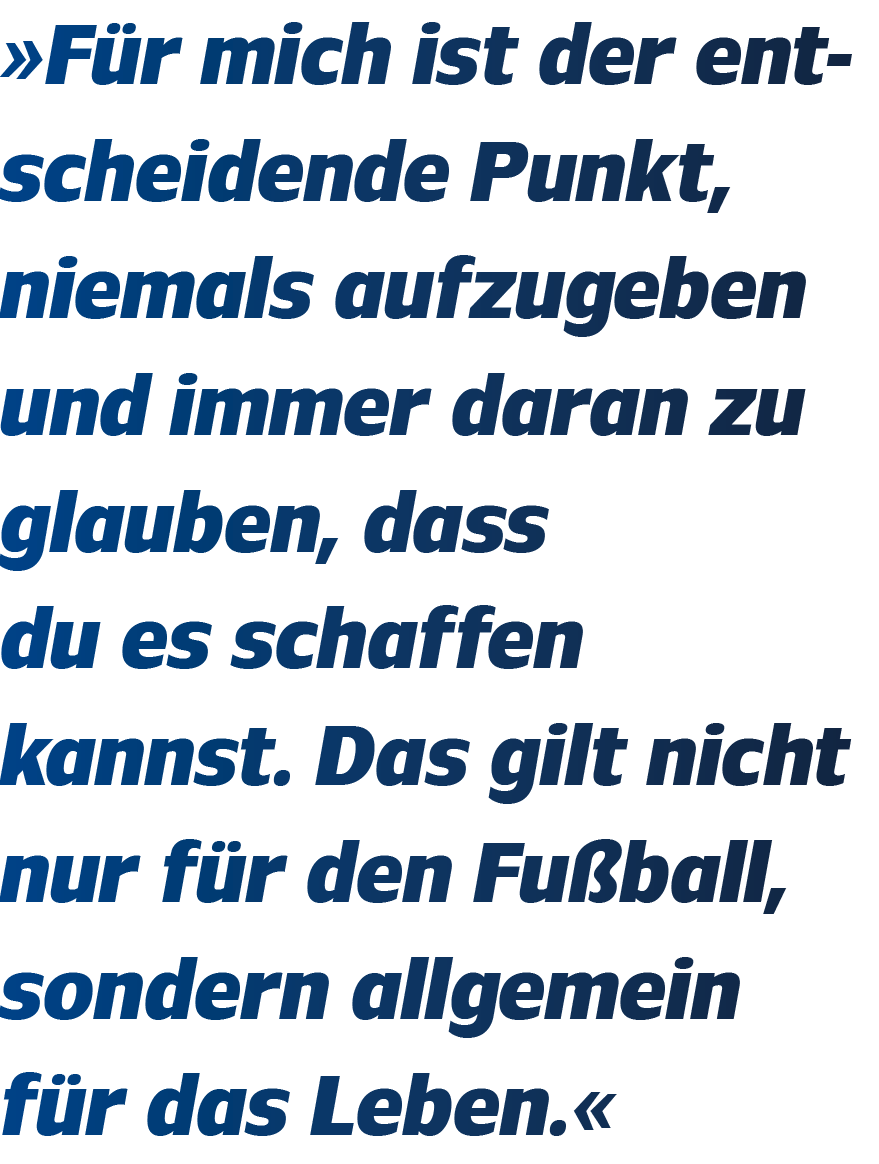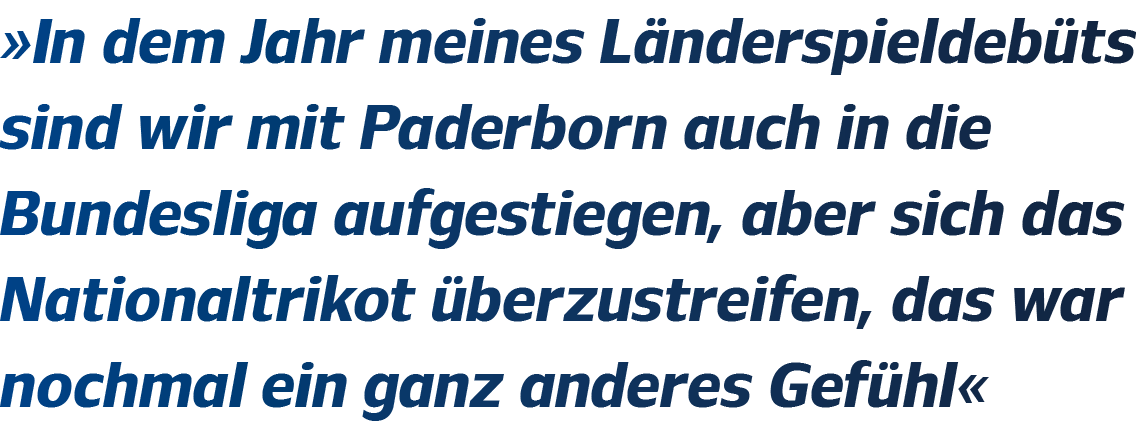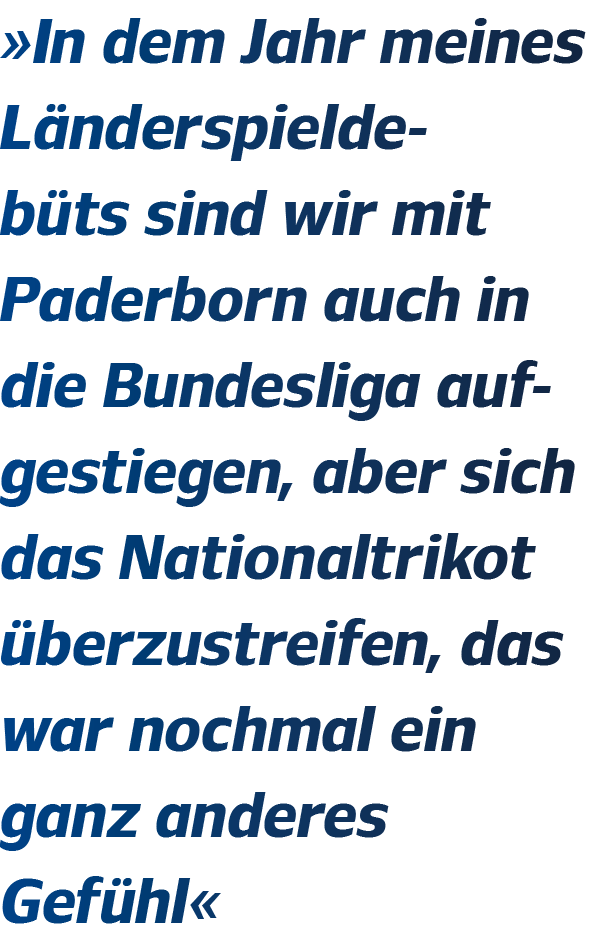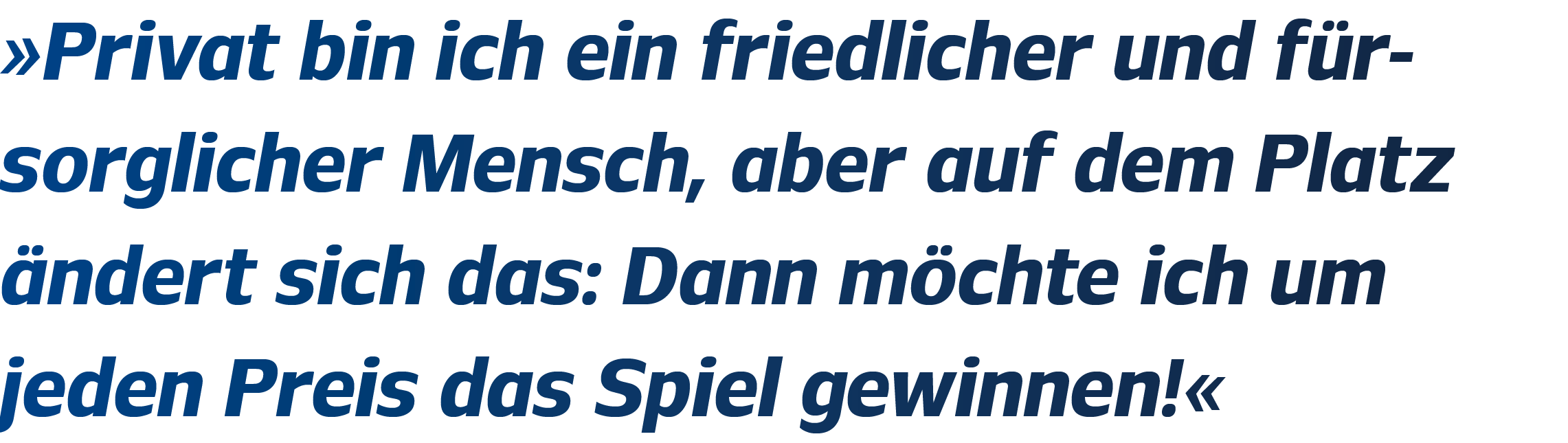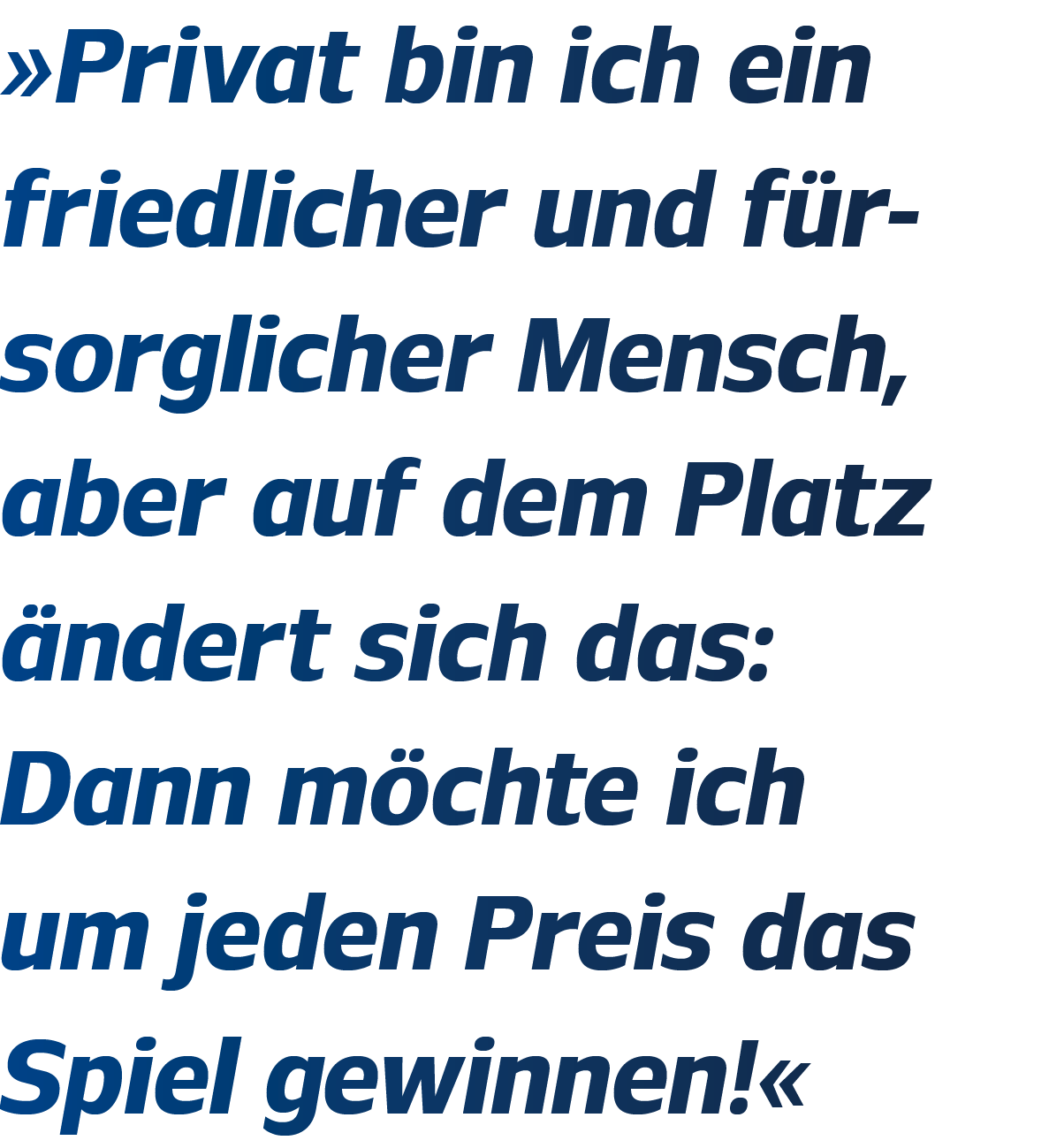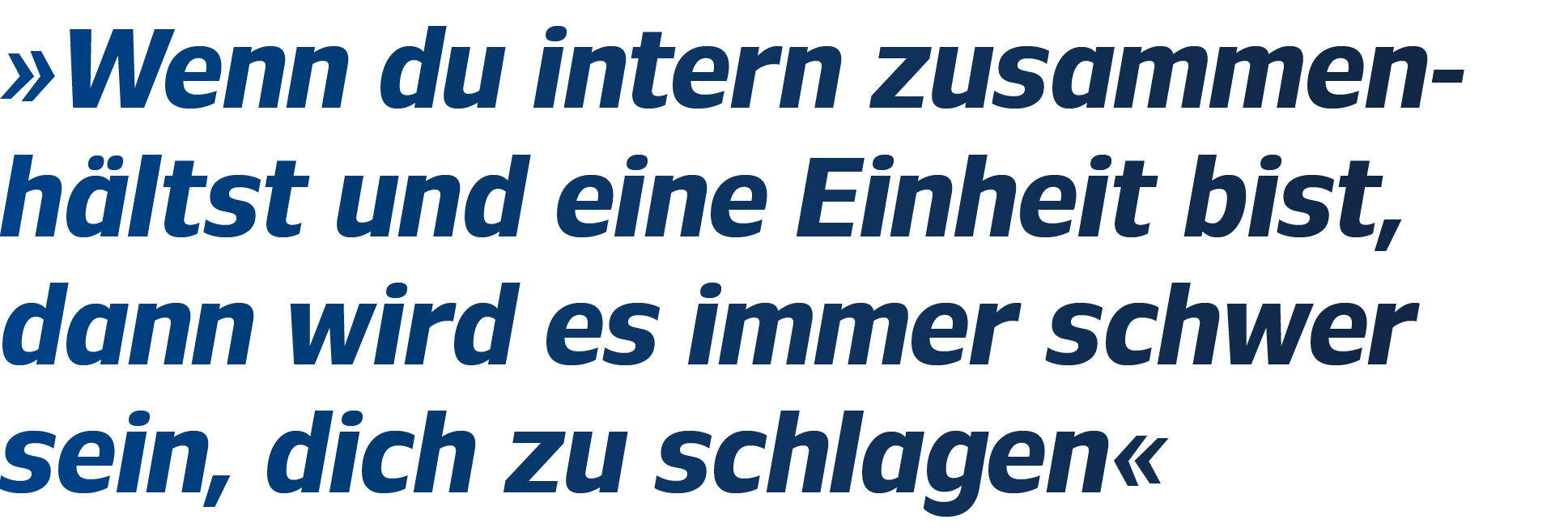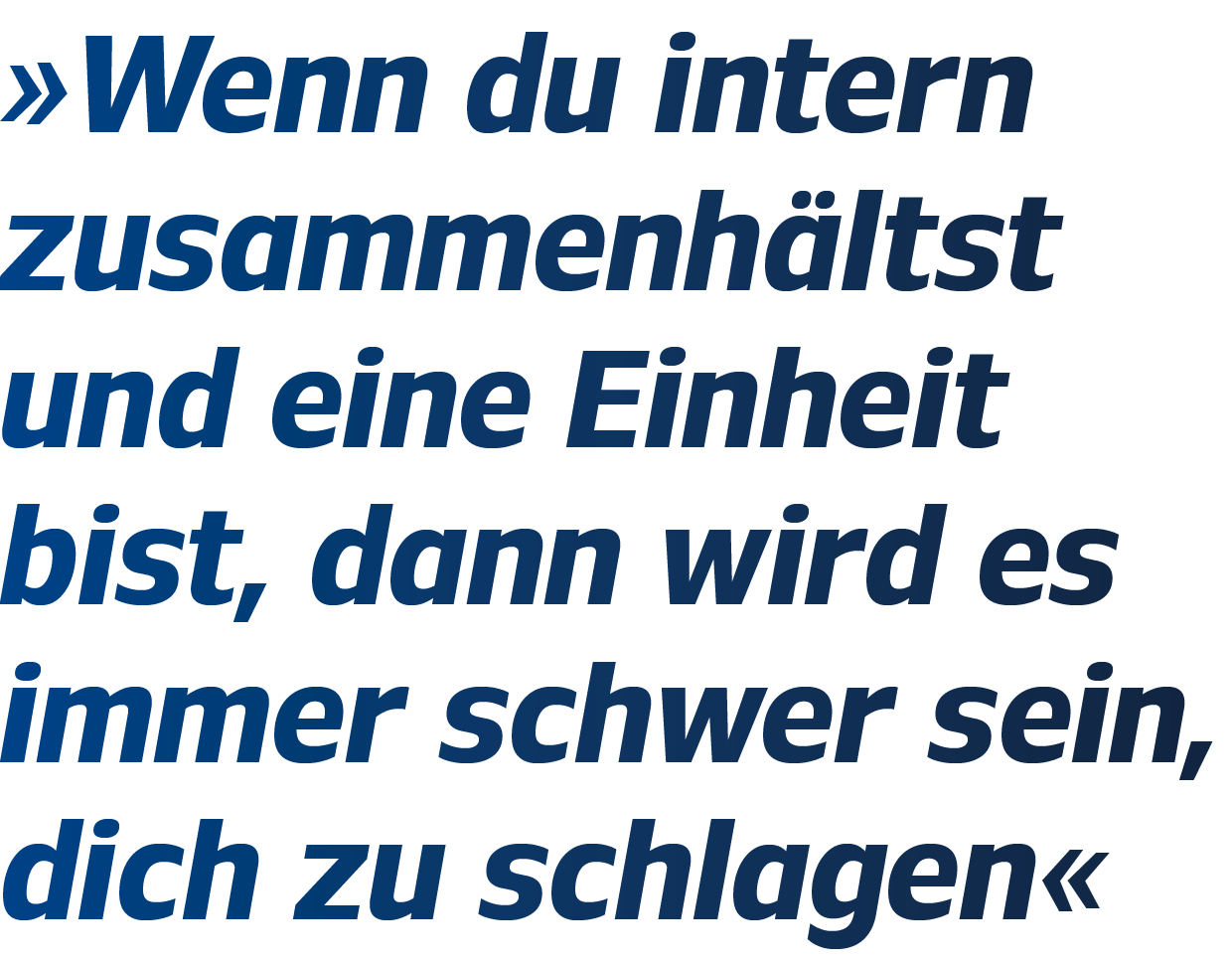Im ausführlichen HSVlive-Interview spricht Defensivallrounder KLAUS GJASULA über sein Image als Abräumer, seinen besonderen Lebensweg von Tirana über Freiburg bis nach Hamburg und seine ebenso ereignis- wie lehrreiche Premierensaison beim HSV.
Wenn Klaus Gjasula auf dem Platz zum Tackling oder zur Grätsche ansetzt, dann wird’s für jeden Gegenspieler ungemütlich. Der 31-jährige Defensivspezialist ist ein Abräumer der alten Schule, setzt im Zweikampf seine Körpergröße von 1,92 Metern und seine Gewichtsmasse von 84 Kilogramm mit jedem Zentimeter und jedem Gramm maximal gewinnbringend ein. Seine robuste Spielweise gepaart mit seinem Carbon-Helm brachten ihm in den Medien den Spitznamen „Gladiator“ ein. Als solcher arbeitete sich Gjasula im vergangenen Jahrzehnt von der Verbandsliga hoch bis in die Bundesliga, debütierte 2019 sogar für die albanische Nationalmannschaft und trug sich zugleich in der Vorsaison mit 17 Gelben Karten in die Rekordbücher der Bundesliga ein. Keine Frage, Klaus Gjasula ist der von Fußballromantikern vielfach gesuchte und im modernen Fußball oftmals vermisste Typ mit Ecken und Kanten, der sein ganz eigenes Image verkörpert. Wie er selbst darüber denkt, worin die Wurzeln seiner Spielweise liegen und warum er als Neuzugang beim HSV zunächst wieder den Schlüssel zu sich selbst finden musste, verrät der beidfüßige Mittelfeldspieler im ausführlichen HSVlive-Interview.
Klaus, in den Medien trägst du den Spitznamen „Gladiator“ – wie gefällt er dir?
Ich finde ihn cool, denn der Spitzname hat etwas. Unabhängig von meiner Person mag ich den Hollywood-Film „Gladiator“ auch sehr. Daran erinnert er mich. Zudem kann ich auch im Hinblick auf mich selbst und mein Spiel damit etwas verbinden.
Im alten Rom wurden Schwertkämpfer so bezeichnet, die auf Leben und Tod gegen andere Gladiatoren oder wilde Tiere kämpften. Gibt es auf dem Fußballplatz auch Gladiatoren?
Natürlich kann man das nicht direkt miteinander vergleichen, aber es gibt im Fußball schon immer wieder Spielertypen, die sprichwörtlich ihr letztes Hemd geben. Zu dieser Sorte zähle ich mich auch. Ich bin ein Spielertyp, der alles auf dem Platz lässt, auch wenn mein Start in Hamburg nicht optimal verlief und die Fans das noch nicht so richtig kennenlernen durften.
In den vergangenen Jahren stand dein Name definitiv für kompromisslosen und kampfbetonten Fußball. Zählst du damit zu einer aussterbenden Spezies im modernen Fußball?
Ich denke, dass sich der Fußball diesbezüglich auf jeden Fall verändert hat. Die junge Spielergeneration ist durch die guten Strukturen im Nachwuchs in vielen Bereichen wirklich top ausgebildet, gleichzeitig gibt es aber immer weniger individuelle Typen. Ich persönlich finde das schade. Und zwar nicht, weil ich persönlich vielleicht auch zu dieser Spezies gehöre, sondern ganz allgemein, weil jede Sportart solche Typen braucht. Sie geben einer Mannschaft, was benötigt wird – besonders in schwierigen Zeiten. In meinen Augen hat der Fußball im Vergleich zu vor zehn bis 15 Jahren, als es diese Typen noch in jedem Club gab, definitiv etwas verloren. Es ist nicht mehr das Gleiche wie früher.