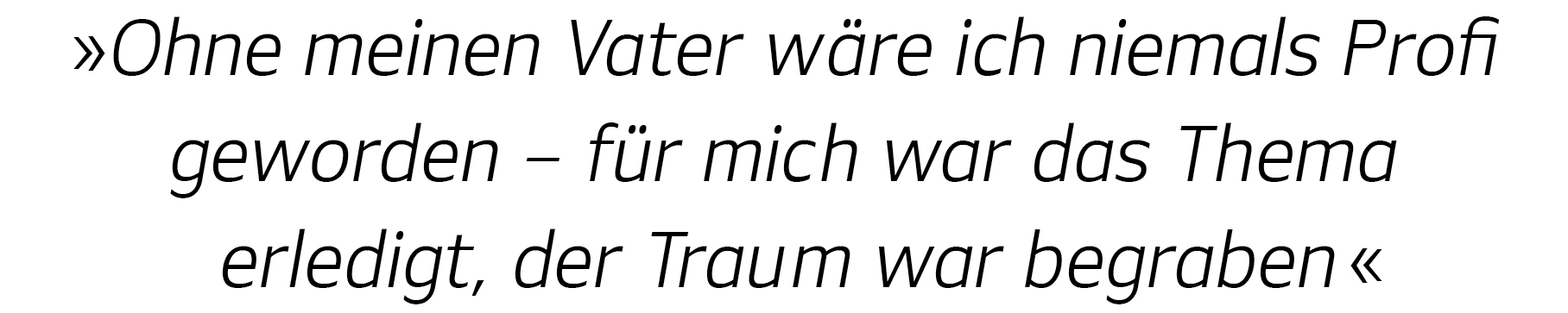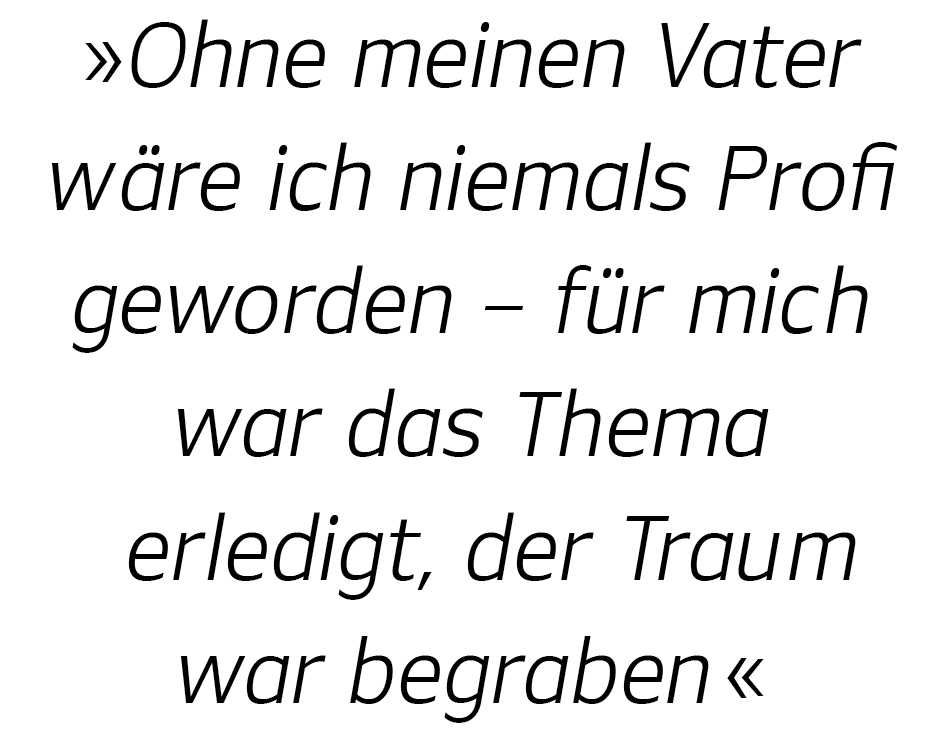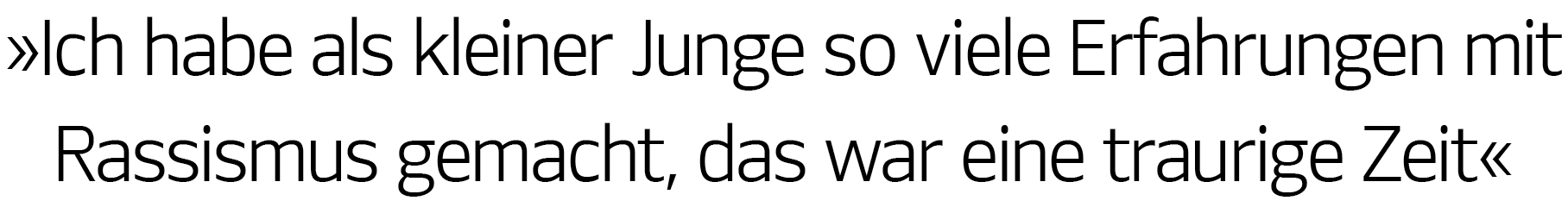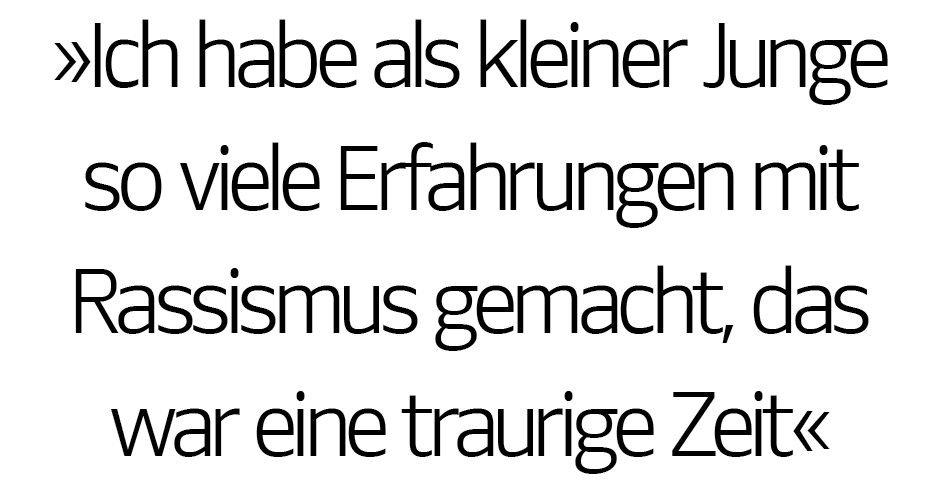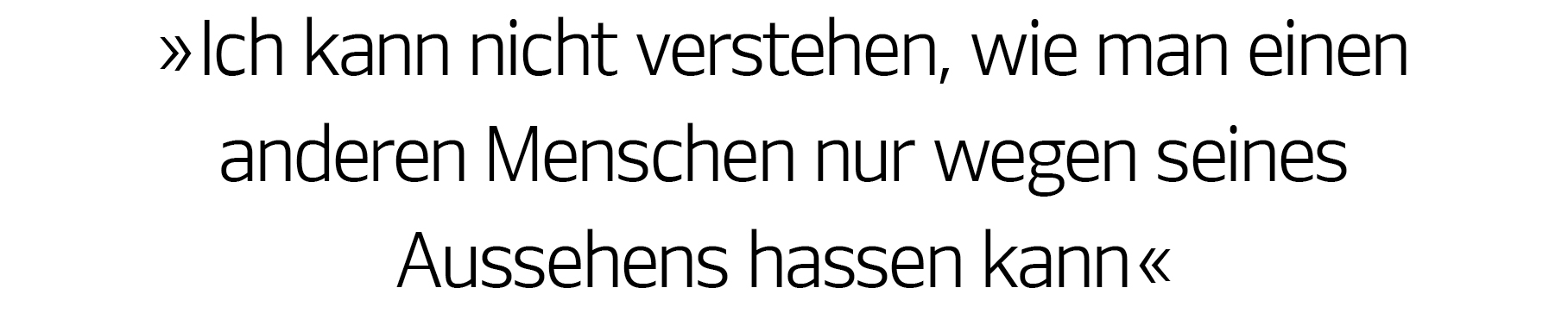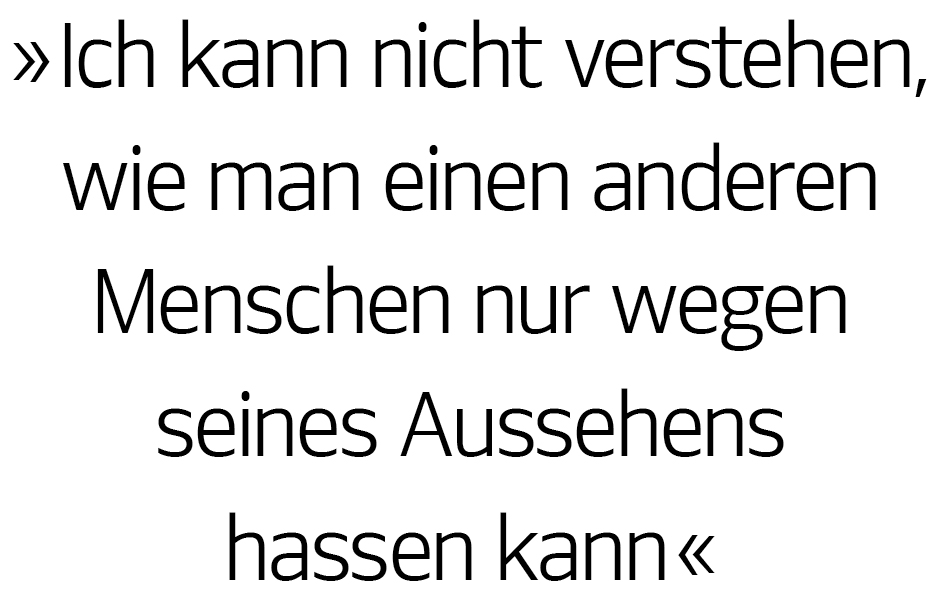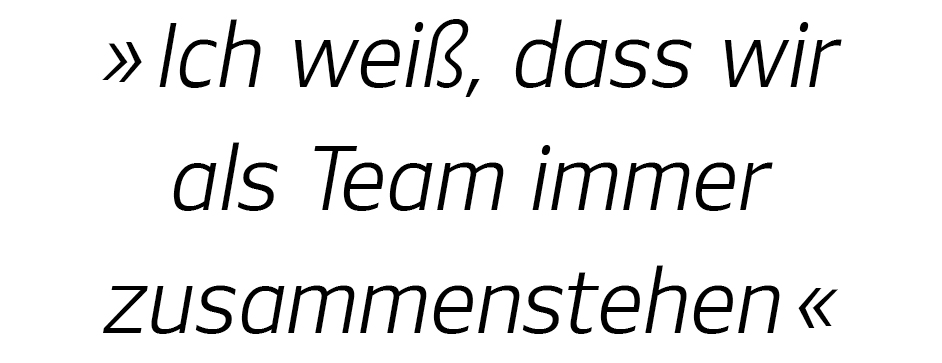Im ausführlichen HSVlive-Interview spricht JAN GYAMERAH über seine ghanaischen Wurzeln, schmerzhafte Erfahrungen mit Rassismus und den großen Zusammenhalt innerhalb des HSV.
Frohnatur – dieser Begriff fällt einem schnell ein, wenn man Jan Gyamerah mit einem Wort beschreiben soll. Immer ein Lachen im Gesicht, stets einen lockeren Spruch auf den Lippen und durchgängig freundlich und höflich im Umgang mit seinen Mitmenschen – der Rechtsverteidiger des HSV, der im Sommer 2019 vom VfL Bochum an die Elbe wechselte, gilt als durch und durch positiver Typ. Ein echter Menschenfreund, der ohne Vorbehalte offen auf andere Menschen zugeht und mit ihnen ebenso leicht wie gern ins Gespräch kommt. Dabei steckt hinter Jan Kwasi Frimpong Gyamerah noch eine ganz andere, eine sehr nachdenkliche und gar verletzliche Seite, die zunächst im Kontrast zu seinem allseits bekannten Wesen zu stehen scheint und am Ende vielleicht eben jenes genauso geformt hat: Als Sohn eines ghanaischen Vaters und einer deutschen Mutter 1995 in Berlin geboren, wächst „Gyambo“ später als Kind und Teenager in der niedersächsischen Kleinstadt Stadthagen auf und erfährt dort aufgrund seiner Hautfarbe immer wieder Rassismus. Im Interview mit dem HSVlive-Magazin spricht der 25-Jährige ungemein offen über diese prägende Zeit und seine Erfahrungen mit einem Thema, das eigentlich keines sein sollte. Ein Gespräch, das den Fußball in sich trägt, gleichzeitig aber weit über ihn hinausgeht und doch dessen grundlegendste Botschaft in sich trägt: Jeder ist gleich.
Jan, was kommt dir als Erstes in den Sinn, wenn du an Ghana, das Heimatland deines Vaters, denkst?
Zuallererst gute Laune und fröhliche Menschen, die mit weniger glücklich sind als wir das hier in Deutschland oder generell in Europa gewohnt sind. Darüber hinaus tolles Wetter und verdammt leckeres Essen.
Inwieweit finden sich deine ghanaischen Wurzeln auch in deinem heutigen Alltag wieder?
Früher haben wir zuhause immer sehr viel afrikanische Musik gehört. Das mache ich auch heute noch sehr gern. Zudem war das Essen zuhause immer wahnsinnig lecker und hat mir später, als ich im Internat gewohnt habe, sehr gefehlt. Durch meinen Wechsel nach Hamburg ist das zuletzt wieder mehr geworden, da es hier eine große Auswahl an afrikanischen Restaurants gibt, so dass ich eigentlich wöchentlich afrikanisch, speziell ghanaisch esse. Einzig die Sprache ist heute nicht mehr so präsent wie früher, als mein Vater jeden Tag Twi gesprochen hat, wenn er mit seiner Familie oder seinen Freunden telefoniert hat.
Weil du die Sprache selbst nicht gelernt hast?
Genau, meine Schwester und ich finden das auch sehr schade, aber unser Vater hat es uns damals nicht beigebracht. Er hat immer sehr großen Wert auf Integration gelegt. Er wollte, dass wir perfekt Deutsch sprechen können, dass das unsere Muttersprache wird und wir sie perfekt beherrschen. Heute ist es leider sehr schwierig, Twi noch zu erlernen. Dass ich damals nicht zweisprachig aufgewachsen bin, ist etwas, was ich im Nachhinein etwas bereue.
Dein Vater ist nun schon mehrfach zur Sprache gekommen: Du hast mal verraten, dass er eine sehr große Rolle für deinen Weg im Fußball gespielt hat. Welche Erinnerungen sind dir diesbezüglich noch besonders präsent?
Ich habe viele Erinnerungen, aber zwei Erlebnisse sind prägend im Kopf geblieben: Zum einen ein Spiel in der E- oder F-Jugend, als ich bei bestem Sommerwetter mit meinen Kumpels eher so über den Platz getrabt bin und wir das Spiel mit 3:10 verloren haben. Daraufhin war mein Vater sehr stinkig, denn Fußball war damals mit Vereins- und Auswahlspielen nicht nur für mich zeitintensiv. Daraufhin hat er gesagt: „Entweder nimmst du es ernst oder nicht. So ein Larifari dazwischen macht keinen Sinn.“ Und der zweite Moment, den ich nie vergessen werde, war, als ich kurz vor den Sommerferien ein Probetraining bei der U15 von Hannover 96 absolviert habe und mir anschließend gesagt wurde, dass die Kaderplanung schon abgeschlossen wäre, so dass ich nicht zu 96 wechseln kann. Ich war damals sehr traurig und habe sogar geweint. Mein Vater hat mich dann sofort zur Seite genommen und hat gesagt: „Hör auf zu heulen. Wenn du wirklich Profi werden willst, dann kommst du auch bei einem anderen Bundesligisten unter.“ Er hat daraufhin bei Arminia Bielefeld angerufen und mich dort für ein Probetraining untergebracht. Und das hat dann auch geklappt.
Dein Vater hat demnach also sogar den entscheidenden Anteil an deiner Profikarriere.
Absolut, ohne meinen Vater wäre ich niemals Profi geworden. Für mich war das Thema nach dem Probetraining in Hannover vorbei, der Traum war begraben. Doch er hat mir gezeigt, dass es nicht nur die eine Möglichkeit, den einen Weg im Leben gibt. Er hat an mich geglaubt und sich für mich eingesetzt. Ich wollte damals schon unbedingt Profi werden, aber ohne ihn und seinen Einsatz wäre es nicht so weit gekommen. Dann hätte ich wohl ein weiteres Jahr in meinem Heimatverein mit meinen Kumpels gespielt und das wäre vielleicht das eine Jahr zu viel gewesen. Ich bin ihm dafür unendlich dankbar.
Als du als Kind und Teenager mit dem Fußball aufgewachsen bist, erlebte die ghanaische Nationalmannschaft im Weltfußball einen besonderen Aufstieg: Bei der WM 2006 in Deutschland ging es ins Achtelfinale, 2010 in Südafrika sogar bis ins Viertelfinale. Wie hast du die Black Stars damals wahrgenommen?
Das war eine ganz besondere Zeit für mich. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland war die erste WM, die ich so richtig verfolgt und hautnah miterlebt habe. Ich kann mich noch genau an jedes Spiel erinnern, habe sofort parat, dass das erste Spiel Ghanas in Hannover gegen Italien war und die Black Stars mit 0:2 gegen den späteren Weltmeister verloren haben. Ich war damals richtig stolz auf diese Mannschaft und habe richtig mitgefiebert. Es war eine coole Truppe mit großen Spielern wie Michael Essien, Stephen Appiah oder Sammy Kuffour. Leider war für die Black Stars damals im Achtelfinale gegen Brasilien Schluss, aber 2010 in Südafrika wurde es umso besser – das war der Wahnsinn.
Inwiefern?
Ghana hatte eine unglaublich starke Mannschaft um Kevin Prince Boateng und hat auf dem Kontinent eine unglaubliche Euphorie ausgelöst. Noch nie stand eine afrikanische Mannschaft im Halbfinale einer Weltmeisterschaft und Ghana war ganz nah dran. Doch leider gab es das traurige Ende im Viertelfinale gegen Uruguay, als Luis Suárez in der letzten Spielminute das Tor per Handspiel auf der Linie verhindert hat, der fällige Elfmeter verschossen wurde und Ghana später im Elfmeterschießen verlor. Damals war ich richtig, richtig traurig. Ich weiß noch, dass wir anschließend in meinen Sommerferien nach Ghana zu unseren Verwandten gereist sind und die Menschen vor Ort unglaublich stolz auf die Nationalmannschaft waren. Zugleich waren sie überhaupt nicht gut auf Suárez zu sprechen. (lacht)
Du hast vorhin schon ein paar Namen der Black Stars genannt. Waren das damals auch deine Vorbilder?
Mein absolutes Vorbild war immer Thierry Henry. Irgendwann kamen dann auch Kevin Prince und Jérôme Boateng dazu. Sie haben den gleichen Background wie ich: die Mutter aus Deutschland, der Vater aus Ghana. Zudem sind sie ebenfalls in Berlin geboren und echte Berliner. Als ein solcher würde ich mich nicht bezeichnen, da ich ja mit meiner Familie relativ früh weggezogen bin, aber ich fand die beiden einfach richtig cool.
Hast du die Boatengs mal kennengelernt? Die Fußballwelt ist ja bekanntlich klein.
Ja, ich habe Kevin Prince mal getroffen. Als ich 2016 für vier Wochen meine Reha in München absolviert habe, war er zur gleichen Zeit auch ein paar Tage da. Kurz zuvor kam seine Biografie heraus. Er hat mir dann das Buch signiert und wir haben zusammen ein Foto gemacht. Ein echt cooles Erlebnis.
Du selbst hast 2012 und 2013 vier Auswahlspiele für die U17 bzw. U18-Nationalmannschaft Deutschlands absolviert. Könntest du es dir heute vorstellen, für die A-Nationalmannschaft Ghanas aufzulaufen?
Ja, auf jeden Fall. Spätestens nach der WM 2010 war das ein Traum von mir, der immer noch lebt. Ich habe damals durch Videos von Kumpels auch ein paar Einblicke in die Mannschaft bekommen, habe gesehen, dass dort eine ganz andere Mentalität zu herrschen scheint. Dort wird im Mannschaftsbus laut Musik gehört, gelacht und getanzt – das ist etwas anderes im Vergleich zu Deutschland. Mich würde es reizen, so etwas mal live mitzuerleben. Bisher gab es leider noch keinen Austausch mit dem ghanaischen Verband, aber so sehr ich mich auch darüber freuen würde: Mein Glück hängt davon am Ende auch nicht ab.